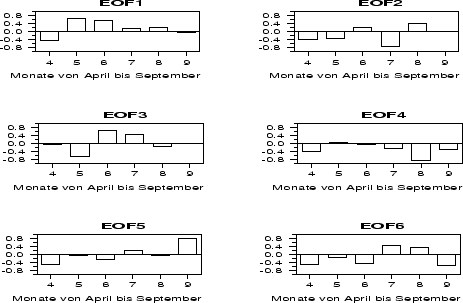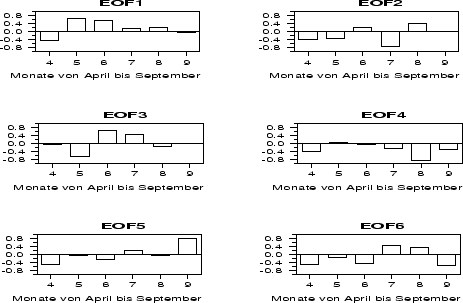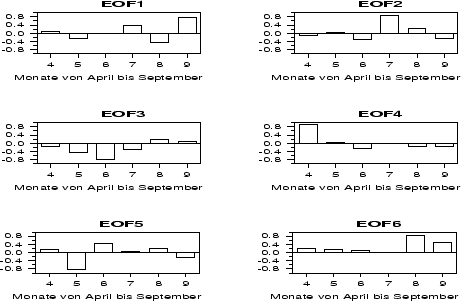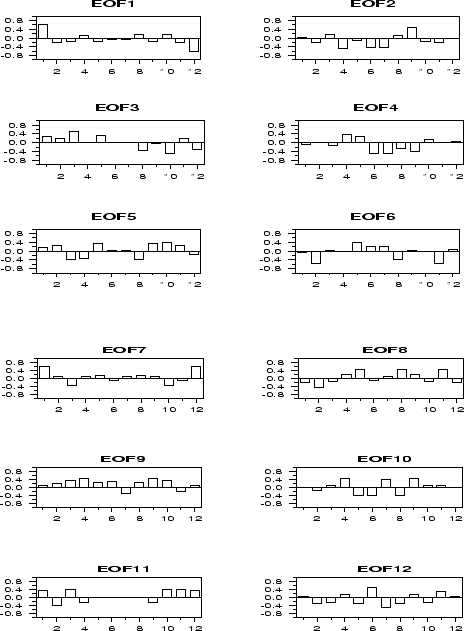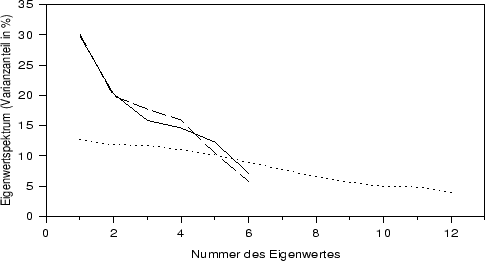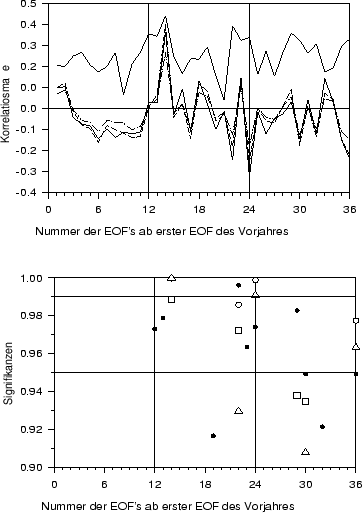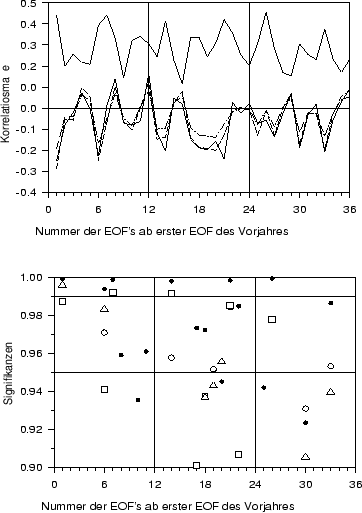Nächste Seite: Sukzessive und multiple Analysen
Aufwärts: Hauptkomponenten der Variation der
Vorherige Seite: Transformationsstrategie
Inhalt
Als eine erste Anwendung der Hauptkomponentenanalyse werden die
Temperatur- und Niederschlagszeitreihen der sechs Monate der Wachstumsperiode
(April-September) hauptachsentransformiert. Die sich daraus ergebenden
EOF sind in den Abbildungen 4.6 und 4.7 dargestellt. Nun kann
man in einem nächsten Schritt die Hauptkomponenten der beiden Klimaelemente
gemeinsam berechnen. Für die Wachstumsperiode bekommt man dann 12
gemeinsame Hauptkomponenten für Niederschlag und Temperatur. In Abbildung
4.8 sind diese 12 EOF in Abhängigkeit von den EOF der reinen
Temperatur- bzw. Niederschlagsvariationen dargestellt.
Abbildung 4.9 zeigt für alle drei EOF-Zerlegungen das sogenannte
Eigenwertspektrum, das angibt, wie sich die Varianz auf die einzelnen
Hauptkomponenten verteilt. Man sieht, daß sowohl bei der Temperatur, als auch
beim Niederschlag die erste EOF etwa 30 %, die ersten beiden EOF zusammen
etwa 50 % der Varianz erklären. Die letzte EOF erklärt jeweils zwischen
6 % und 7% der Varianz, was nicht ohne weiteres vernachlässigbar erscheint.
Die Eigenwerte der gemeinsamen Hauptkomponenten nehmen noch deutlich weniger
steil ab, wie das bei den einzelnen Klimaelementen der Fall ist. Von den
12 Eigenwerten ist der erste schon unter 13%; der letze bei 4 %.
Abbildung:
Empirische
Orthogonalfunktionen der Sommermonatstemperaturen
(April-September) von Potsdam für die Zeit von 1891 bis 1991.
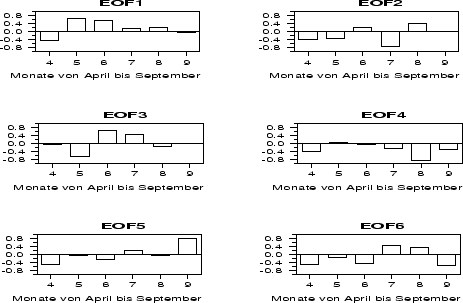 |
Abbildung:
Empirische
Orthogonalfunktionen der Sommermonatsniederschläge
(April-September) von Potsdam für die Zeit von 1891 bis 1991.
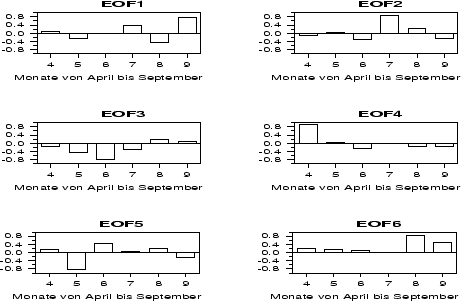 |
Abbildung:
Empirische
Orthogonalfunktionen der Sommermonatstemperaturen und -niederschläge
(April-September) von Potsdam für die Zeit von 1891 bis 1991
4.8.
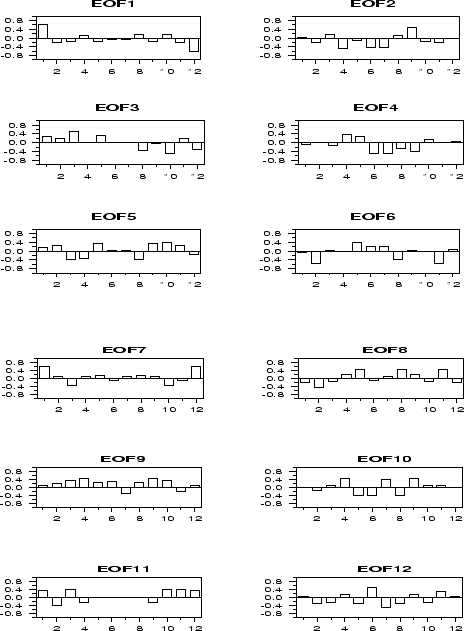 |
Abbildung:
Eigenwertspektren der EOF von
Sommertemperaturen (durchgezogene Linie), Sommerniederschlägen
(unterbrochene Linie) und der Kombination aus beidem (gepunktete Linie).
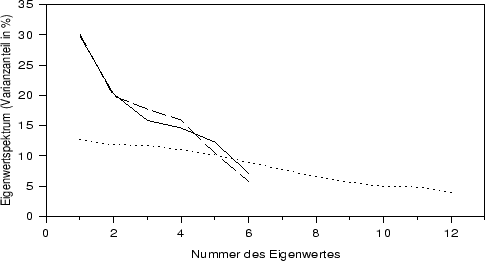 |
Im nächsten Schritt stellt sich nun die Frage, welche der Hauptkomponenten
einen Zusammenhang mit der Zeitreihe der Jahrringbreiten zeigen. Dazu sind
in den Abbildungen 4.10 und 4.11 die Zusammenhänge zwischen
den PC-Zeitreihen der Temperatur und des Niederschlags einerseits
(jeweils auf der Grundlage aller 12 Kalendermonate berechnet)
und der
Zeitreihe der Jahrringbreiten andererseits dargestellt. Dazu werden wieder
die in Abschnitt 4.3.1 eingeführten Verfahren verwendet.
Abb. 4.10 zeigt keinen signifikanten Zusammenhang zu irgendeiner
Temperaturvariation des Vorjahres. Die erste EOF der Temperatur des Jahres
des Baumrings wird ein hoch signifikanter nicht-linearer und nicht-monotoner
Zusammenhang selektiert, der in einem Scatterdiagramm genauer untersucht
werden sollte. Zur zweiten EOF der Temperatur besteht ein linearer
und zur dritten wieder ein nicht-linearer und nicht-monotoner Zusammenhang.
Auch für die zehnte, elfte und zwölfte EOF und einige EOF des Folgejahres
findet man signifikante Zusammenhänge.
Beim Niederschlag findet man zahlreiche lineare sowie nicht-lineare und
nicht-monotone Zusammenhänge, die ein recht uneinheitliches Bild ergeben.
Abbildung:
Oben: Verschiedene Maße des Zusammenhangs zwischen der
Zeitreihe der Jahrringbreiten von Kiefern in Brandenburg und
den EOF der monatlichen Mitteltemperaturen in Potsdam zwischen
1891 und 1991: Transinformation
(dicke durchgezogene Linie), Pearson-Korrelation (dünne durchgezogene Linie),
Spearman-Korrelation (dünne unterbrochene Linie) und Kendall-Korrelation
(Strichpunktlinie).
Unten: Verschiedene Signifikanzmaße: Quadrate  ,
,
 Signifikanz der Spearman-Korrelation,
Signifikanz der Spearman-Korrelation,  Signifikanz der Pearson-Korrelation und
Signifikanz der Pearson-Korrelation und  Signifikanz der
Transinformation.
Signifikanz der
Transinformation.
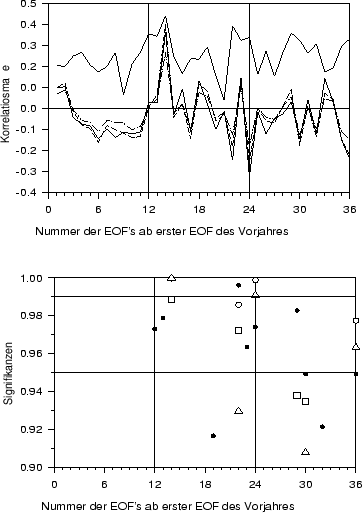 |
Abbildung:
Oben: Verschiedene Maße des Zusammenhangs zwischen der
Zeitreihe der Jahrringbreiten von Kiefern in Brandenburg und den EOF der
monatlichen
Niederschlagssummen in Potsdam zwischen 1891 und 1991: Transinformation
(dicke durchgezogene Linie), Pearson-Korrelation (dünne durchgezogene Linie),
Spearman-Korrelation (dünne unterbrochene Linie) und Kendall-Korrelation
(Strichpunktlinie).
Unten: Verschiedene Signifikanzmaße: Quadrate  ,
,
 Signifikanz der Spearman-Korrelation,
Signifikanz der Spearman-Korrelation,  Signifikanz der Pearson-Korrelation und
Signifikanz der Pearson-Korrelation und  Signifikanz der
Transinformation.
Signifikanz der
Transinformation.
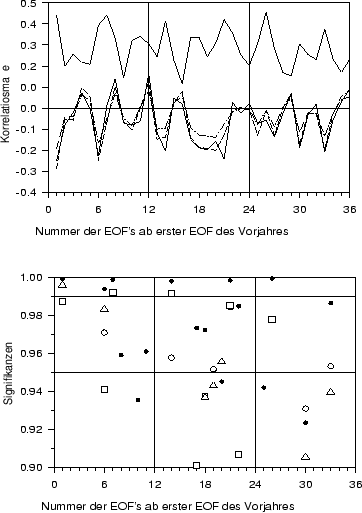 |




Nächste Seite: Sukzessive und multiple Analysen
Aufwärts: Hauptkomponenten der Variation der
Vorherige Seite: Transformationsstrategie
Inhalt
ich
2000-01-24